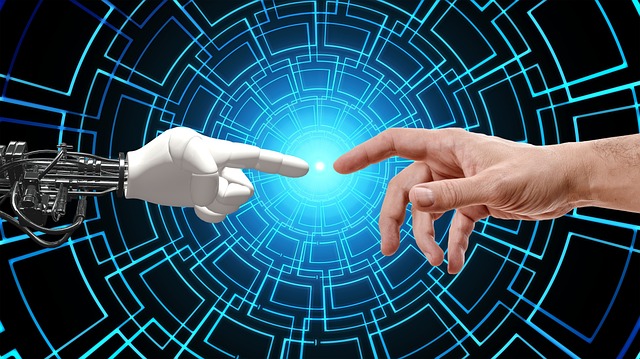Jan. 25, 2024 | Aktuelles
Pressemitteilung BFB vom 16. Januar 2024
Schmidt: „Fachkräftelücke von rund 263.000 offenen Stellen“
▪ Knapp jede zweite Freiberuflerin, jeder zweite Freiberufler hat unbesetzte Stellen
▪ Überlastung durch fehlendes Personal verschärft sich
▪ Administrativer Aufwand kostet 27 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit
▪ Fast die Hälfte befürchtet, nur noch ein Jahr durchhalten zu können
„Ein hohes Kostenniveau, ein kritisches Marktumfeld auch aufgrund der steigenden Gesamtzahl von Insolvenzen sowie innenpolitische Unwägbarkeiten dämpfen die Zuversicht der Freiberuflerinnen und Freiberufler. Überdies arbeiten mehr und mehr von ihnen gemeinsam mit ihren Teams über Anschlag“, so BFB-Präsident Friedemann Schmidt zur aktuellen BFB-Konjunkturumfrage. Betroffen ist derzeit fast jede zweite Freiberuflerin, jeder zweite Freiberufler. Im Vorwinter war es rund jede, jeder Dritte. Weiterhin schätzt nur rund jede, jeder dritte Befragte ihre, seine aktuelle Geschäftslage als gut ein. „Und nicht einmal jede, jeder Zehnte erwartet im kommenden Halbjahr eine günstigere Entwicklung. Selbst dieser im Vorjahresvergleich leicht zuversichtlichere Ausblick ist mit Unsicherheiten behaftet, was sich am Geschäftsklima ablesen lässt“, so der BFB-Präsident.
Und er sagt gerade mit Blick auf den Sonderteil zum Fachkräftemangel weiter: „Der Fachkräftemangel ist bis tief in die Praxen, Kanzleien, Büros und Apotheken vorgedrungen. Die Mangelerscheinungen gewinnen mehr und mehr an Wucht. Im Großen, da die Freien Berufe ihre Potenziale für die Zukunftsaufgabe und mithin auch für das Wirtschaftswachstum nicht entfalten können. Aber auch im persönlichen Vertrauensraum mit Patientin, Mandant, Klientin und Kunde. Auch wenn sich die Freiberuflerinnen und Freiberufler gemeinsam mit ihren Teams – oft auch weit über Anschlag – und bei steigender Arbeitsbelastung gegen den Trend stemmen, mussten gut zwei Drittel der Befragten Aufträge, Behandlungen, Mandate etc. bereits ablehnen. Mehr als jede, jeder Vierte der Befragten erwartet, das vertraute Spektrum höchstens noch ein Jahr erbringen zu können.
Aus Sicht der Befragten muss politisch insbesondere gegengesteuert werden, indem in den freiberuflichen Praxen, Kanzleien, Büros und Apotheken gerade die Ressource Zeit geschont wird, um davon eben mehr für Patientinnen, Mandanten, Klientinnen und Kunden zu haben. Im Schnitt wenden die Befragten 27 Prozent ihrer Wochenarbeitszeit für bürokratische Tätigkeiten auf, die nicht zu den Kernaspekten ihrer freiberuflichen Tätigkeit zählen. Mehrheitlich sprechen sie sich zudem dafür aus, die schulische Berufsorientierung zu stärken und eine bessere schulische Qualifikation zu fördern, um junge Menschen gemäß ihren Talenten auf ihrem Weg in die Berufs- und Arbeitswelt zu begleiten.
In Summe fehlen den Freien Berufen rund 160.000 Fachkräfte, 53.000 angestellte Berufsträgerinnen und Berufsträger sowie 50.200 Auszubildende. Das sind in Summe rund 263.200. Eine enorme Fachkräftelücke bemessen an den insgesamt rund 4,6 Millionen Beschäftigten in freiberuflichen Teams. Der letztverfügbare Wert aus dem Herbst 2022 lag bei 340.000. Im Vergleich hat sich die Situation bei den Auszubildenden nochmals verschärft. Bei den Berufsträgerinnen und Berufsträgern sowie Fachkräften hat sich die Lage etwas verbessert, was sich auch in der jüngsten Freiberufler-Statistik widerspiegelt, die ein merkliches Plus bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ausweist.
Der Blick auf die einzelnen Beschäftigtengruppen zeigt, dass der Bedarf gerade in den Kernbereichen der freiberuflichen Vertrauensdienstleistungen und damit beim direkten Kontakt zu Patientinnen, Mandanten, Klientinnen und Kunden besorgniserregend hoch ist. Das legt den Schluss nahe, dass die Freiberuflerinnen und Freiberufler mit ihrer Rekrutierungsstrategie hierauf einen Schwerpunkt legen – was auch unsere Freiberufler-Statistik zeigt.
Allerdings wird sich das Vakuum noch ausweiten. Jede, jeder Vierte der Befragten rechnet damit, auch 2024 noch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu brauchen. Allerdings befürchten fast zwei Drittel der Befragten große bis sehr große Schwierigkeiten. Die führen auch dazu, dass es immer länger dauert, bis eine Kandidatin, ein Kandidat eingestellt werden kann. Durchschnittlich dauert die Personalsuche bei den Freien Berufen derzeit zehn Monate und wird sich weiter erschweren: Diejenigen, die immer noch nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen, gehen davon aus, dass sie durchschnittlich 15 Monate suchen werden. Betrieblicher Bedarf und dessen Deckung fallen also immer weiter auseinander. Gleichzeitig nimmt so die Belastung auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu, was die Wahrscheinlichkeit für Personalausfälle oder gar Austritte erhöht.“
Aktuelle Geschäftslage
Ihre aktuelle Geschäftslage schätzen 38,1 Prozent der befragten Freiberuflerinnen und Freiberufler als gut ein, 43,6 Prozent als befriedigend und 18,3 Prozent als schlecht. Verglichen mit den Vorjahreswerten verbessert sich die Stimmung leicht: Im Winter 2022 beurteilten 37,7 Prozent der Befragten ihre Lage als gut, 40,9 Prozent als befriedigend und 21,4 Prozent als schlecht.
Drei von vier Freiberufler-Gruppen bewerten ihre aktuelle Lage etwas besser als im Vorwinter. Die rechts-, steuer- und wirtschaftsberatenden Freien Berufe sind noch am zuversichtlichsten, gefolgt von den technisch-naturwissenschaftlichen Freien Berufen und den freien Kulturberufen. Die Freien Heilberufe bewerten ihre aktuelle Lage schlechter.
Sechsmonatsprognose
9,5 Prozent erwarten eine günstigere Entwicklung, 52,5 Prozent einen gleichbleibenden und 38 Prozent einen ungünstigeren Verlauf. Auch hier verändern sich die Werte gegenüber dem Vorwinter leicht ins Positive. 7,1 Prozent rechneten seinerzeit mit einer günstigeren, 47,1 Prozent mit einer gleichbleibenden und 45,8 Prozent mit einer ungünstigeren Entwicklung. Da aktuell deutlich mehr Freiberuflerinnen und Freiberufler einen ungünstigeren als einen günstigeren Verlauf befürchten, ergibt sich eine negative Geschäftserwartung.
Alle vier Freiberufler‐Gruppen sind zuversichtlicher als im Vorwinter: Freie Heilberufe und technisch-naturwissenschaftliche Freiberufler sind dabei am kritischsten. Die rechts‐, steuer‐ und wirtschaftsberatenden und die freien Kulturberufe sind vergleichsweise zuversichtlicher.
Personalplanung
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Anteil derer, die davon ausgehen, innerhalb der nächsten zwei Jahre mehr Beschäftigte in ihrem Unternehmen zu haben, um 5,3 Prozentpunkte auf 17,1 Prozent erhöht. Gleichzeitig ist der Anteil derer, die damit rechnen, weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen, nochmals um 6,1 Prozentpunkte auf 27,5 Prozent geklettert. Mit einem gleichbleibenden Mitarbeiterstamm rechnen 55,4 Prozent der Befragten.
Konjunkturbarometer
Die aktuelle Geschäftslage wird von den Freien Berufen deutlich besser bewertet, als dies gesamtwirtschaftlich der Fall ist. Allerdings sind die Geschäftserwartungen der Freien Berufe gleichermaßen negativ, wie es auch die Gesamtwirtschaft abbildet. Hieraus resultiert auch für die Freien Berufe ein leicht negatives Geschäftsklima.
Aktuelle Auslastung der Kapazitäten
Für 47,8 Prozent der Befragten sind ihre Kapazitäten bereits überschritten. Im Vorwinter lag der Wert bei 35,1 Prozent. 36,8 Prozent sind zu mehr als 75 Prozent bis zu 100 Prozent ausgelastet, 10,1 Prozent zu mehr als 50 Prozent bis zu 75 Prozent, 3,5 Prozent zu mehr als einem Viertel bis zur Hälfte und 1,8 Prozent bis zu einem Viertel. Bei 56,7 Prozent von denjenigen, die überausgelastet sind, sind die Kapazitäten bis zu einem Viertel überschritten, bei 33,3 Prozent um mehr als 25 bis 50 Prozent, bei zehn Prozent um mehr als die Hälfte.
Perspektivische Auslastung
14,3 Prozent der Befragten erwarten binnen der kommenden sechs Monate eine Überauslastung und 18,2 Prozent innerhalb der nächsten zwei Jahre. Diese Werte lagen im Winter 2022 noch bei 10,2 und 13,8 Prozent.
Gründe für Überauslastung
Für 64,2 Prozent ist der zentrale Grund der Überauslastung das Problem, zusätzliche Fachkräfte zu finden. Mit 58,5 Prozent ist der am zweithäufigsten genannte Grund eine zu hohe Nachfrage. 26,9 Prozent der Befragten geben zudem an, auch kein zusätzliches Personal, beispielsweise für das Sekretariat, zu finden.
Hier zeigt sich zudem, dass die zu hohe Nachfrage, die seit Jahren die Top 3 der Gründe für die Überauslastung anführt, zum ersten Mal durch einen anderen Aspekt – die Probleme, Fachkräfte zu finden – abgelöst wurde. Dies betont den Fachkräftemangel als zentralen limitierenden Faktor der freiberuflichen Tätigkeit.
Stellenbesetzungsprobleme
Hiernach gefragt geben 85,2 Prozent an, dass schlichtweg Bewerberinnen und Bewerber fehlen. Andere Gründe, wie zu geringe oder nicht passende Qualifikation oder eine unterschiedliche Lohnvorstellung, werden dabei mit Abstand seltener als Problem angesehen.
Sonderthema Fachkräftemangel
Unbesetzte Stellen
Knapp jede zweite Freiberuflerin, jeder zweite Freiberufler hat unbesetzte Stellen (46,8 Prozent), 53,2 Prozent nicht. Besonders hoch ist der Bedarf der freien Heilberufe, mit Abstand folgen die rechts-, steuer- und wirtschaftsberatenden und die technisch-naturwissenschaftlichen Freiberuflerinnen und Freiberufler, weniger betroffen sind die freien Kulturberufe. Der Bedarf steigt überdies mit zunehmender Unternehmensgröße an.
Fachkräftelücke
Mit 57,8 Prozent haben mehr als die Hälfte der Befragten bis zu eine offene Stelle. Etwa ein Viertel hat ein bis zwei vakante Positionen und weitere knapp elf Prozent zwischen zwei und fünf offene Posten zu besetzen. Mit 5,4 Prozent ist der Anteil derer, die mehr als fünf unbesetzte Stellen zu verzeichnen haben, eher gering.
Aktueller Bedarf nach Beschäftigtengruppen
Gefragt nach den einzelnen Beschäftigtengruppen geben 68 Prozent der Befragten an, dass ihnen speziell freiberufliche angestellte Fachkräfte fehlen, 47,3 Prozent sehen dies mit Blick auf die bei ihnen anzustellenden Freiberuflerinnen und Freiberufler, 35,4 Prozent bei Auszubildenden und 32,4 Prozent bei sonstigen angestellten Fachkräften.
Geschätzter Bedarf nach Beschäftigtengruppen im Jahr 2024
Von einem weiterhin steigenden Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehen 26,6 Prozent der Befragten aus. 60,1 Prozent der Freiberuflerinnen und Freiberufler rechnen mit einem gleichbleibend hohen Personalbedarf. Mit 13,3 Prozent fällt der Anteil derer, die einen geringeren Bedarf annehmen, kleiner aus.
Betrachtet nach Beschäftigtengruppen ergeben sich steigende Bedarfe gerade im Kernbereich der freiberuflichen Leistung. Für das kommende Jahr erwarten die Befragten keine Entspannung, denn der Bedarf steigt weiter. 36,6 Prozent wollen noch mehr speziell freiberufliche angestellte Fachkräfte und 29,7 Prozent weitere Freiberuflerinnen und Freiberufler einstellen. Mit Blick auf sonstige Fachkräfte geben dies 20,4 Prozent und in Bezug auf Auszubildende 19,5 Prozent an.
Bewertung Personalsuche 2023
2023 hatten 90,5 Prozent große bis sehr große Schwierigkeiten, Personal zu finden. Im Vergleich zu 2022 war es für 49,8 Prozent schwieriger, für 47 Prozent machte es keinen Unterschied, einfacher fanden es 3,2 Prozent.
Schwierigkeiten, Bedarf 2024 zu decken
Insgesamt rechnen mit rund 61 Prozent mehr als die Hälfte der Befragten damit, dass die Deckung des Personalbedarfs mit großen bis sehr großen Schwierigkeiten einhergehen wird. Nur 21 Prozent sehen hier keine und knapp 18 Prozent eher geringe Schwierigkeiten auf sich zukommen.
So erwarten rund 74 Prozent der Befragten große bis sehr große Schwierigkeiten bei ihrer Suche nach angestellten speziell freiberuflichen Fachkräften, bei angestellten Berufsträgerinnen und Berufsträgern erwarten dies 62,5 Prozent, bei Auszubildenden 58,2 Prozent und bei sonstigen Fachkräften 51 Prozent.
Dauer der Suche nach Personal – Rückblick
Im Mittel gaben die Befragten an, dass sie zehn Monate gesucht hätten, bevor eine vakante Stelle besetzt werden konnte. Bis drei Monate gaben 28,9 Prozent an, über drei bis sechs Monate 26,5 Prozent, über sechs bis zwölf Monate 28,9 Prozent, über ein bis zwei Jahre 10,6 Prozent und mehr als zwei Jahre 5,1 Prozent.
Bei angestellten Berufsträgerinnen und Berufsträgern betrug diese Suchdauer im Durchschnitt 14 Monate. Bis drei Monate gaben 21,7 Prozent an, über drei bis sechs Monate 20,4 Prozent, über sechs bis zwölf Monate 33 Prozent, über ein bis zwei Jahre 14,1 Prozent und mehr als zwei Jahre 10,8 Prozent.
Nach angestellten speziell freiberuflichen Fachkräften wurde durchschnittlich zehn Monate gesucht. Bis drei Monate gaben 20,6 Prozent an, über drei bis sechs Monate 28,4 Prozent, über sechs bis zwölf Monate 32,8 Prozent, über ein bis zwei Jahre 12,6 Prozent und mehr als zwei Jahre 5,6 Prozent.
Sonstige Fachkräfte wurden im Durchschnitt binnen sieben Monaten gefunden. Bis drei Monate gaben 45,3 Prozent an, über drei bis sechs Monate 27,6 Prozent, über sechs bis zwölf Monate 20,4 Prozent, über ein bis zwei Jahre 4,7 Prozent und mehr als zwei Jahre zwei Prozent.
Auf der Suche nach Auszubildenden waren die Befragten durchschnittlich neun Monate. Bis drei Monate gaben 27,9 Prozent an, über drei bis sechs Monate 29,7 Prozent, über sechs bis zwölf Monate 29,5 Prozent, über ein bis zwei Jahre 11,1 Prozent und mehr als zwei Jahre 1,8 Prozent.
Dauer der Suche nach Personal– Ausblick
Diejenigen, die immer noch nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen, gehen davon aus, dass sie durchschnittlich 15 Monate suchen werden. Bis drei Monate gaben 17 Prozent an, über drei bis sechs Monate 22 Prozent, über sechs bis zwölf Monate 30,3 Prozent, über ein bis zwei Jahre 19,4 Prozent und mehr als zwei Jahre 11,3 Prozent.
Mit Blick auf vakante Stellen gaben die Befragten an, dass sie damit rechnen, im Durchschnitt 19 Monate nach angestellten Berufsträgerinnen und Berufsträgern suchen zu müssen. Bis drei Monate gaben 9,4 Prozent an, über drei bis sechs Monate 15,6 Prozent, über sechs bis zwölf Monate 34,1 Prozent, über ein bis zwei Jahre 20,7 Prozent und mehr als zwei Jahre 20,2 Prozent.
Nach angestellten speziell freiberuflichen Fachkräften befürchten die Befragten im Durchschnitt 16 Monate suchen zu müssen. Bis drei Monate gaben 12,3 Prozent an, über drei bis sechs Monate 18,7 Prozent, über sechs bis zwölf Monate 32,2 Prozent, über ein bis zwei Jahre 23,2 Prozent und mehr als zwei Jahre 13,6 Prozent.
Sonstige Fachkräfte erwarten sie nach durchschnittlich elf Monaten einstellen zu können. Bis drei Monate gaben 25,4 Prozent an, über drei bis sechs Monate 26 Prozent, über sechs bis zwölf Monate 25,9 Prozent, über ein bis zwei Jahre 17,5 Prozent und mehr als zwei Jahre zwei 5,2 Prozent.
Bei Auszubildenden gehen die Befragten von einer Zeitspanne von 14 Monaten aus. Bis drei Monate gaben 14,4 Prozent an, über drei bis sechs Monate 19,2 Prozent, über sechs bis zwölf Monate 40,7 Prozent, über ein bis zwei Jahre 19,2 Prozent und mehr als zwei Jahre 6,5 Prozent.
Besetzungsprobleme
Bei angestellten Berufsträgerinnen und Berufsträgern sind zu wenige Bewerbungen das Hauptproblem, 57,3 Prozent der Befragten gaben dies an, ebenso bei freiberuflichen Fachkräften (53,6 Prozent). Bei angestellten Fachkräften ist fehlende Berufserfahrung das Hauptmanko (34,7 Prozent) und bei Auszubildenden eine mangelnde Ausbildungsreife (58,6 Prozent).
Geforderte Maßnahmen: Top 10
- Ressourcenverbrauch (z. B. Zeit) durch Bürokratie verringern: 64,8 Prozent
- Schulische Berufsorientierung stärken: 55,2 Prozent
- Bessere schulische Qualifikation fördern: 52,9 Prozent
- Flexible Arbeitszeitmodelle: 42,6 Prozent
- Arbeit über die Altersgrenze hinaus attraktiver gestalten: 40,9 Prozent
- Qualifizierte Migration fördern: 40,7 Prozent
- Förderung von Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 34,9 Prozent
- Mobilitätsunterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 30,9 Prozent
- Verlängerung der Lebensarbeitszeit: 21,4 Prozent
- Stärkerer Einsatz digitaler Tools: 20,3 Prozent
Eigene Maßnahmen: Top 10
- Fort- und Weiterbildung stärken: 55,6 Prozent
- Annahme von weniger Aufträgen: 50,6 Prozent
- Teilzeitoptionen für Eltern ausbauen: 47,4 Prozent
- Anpassung der Aufgaben bestehender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Ausgleich unbesetzter Stellen: 42,5 Prozent
- Mehr Digitalisierung: 39,3 Prozent
- Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gezielt fördern: 28,1 Prozent
- Vermehrter Einsatz von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: 17,8 Prozent
- Jugendliche ohne Berufsausbildung qualifizieren: 12,4 Prozent
- Einsatz Künstlicher Intelligenz: 11,9 Prozent
- Zeitarbeit: 2,2 Prozent
Wirksamkeit der eigenen Maßnahmen
- Teilzeitoptionen für Eltern ausbauen: 4,18
- Mehr Digitalisierung: 4,14
- Annahme von weniger Aufträgen: 4,05
- Einsatz Künstlicher Intelligenz: 4,02
- Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gezielt fördern: 3,9
- Fort- und Weiterbildung stärken: 3,88
- Jugendliche ohne Berufsausbildung qualifizieren: 3,81
- Anpassung der Aufgaben bestehender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Ausgleich unbesetzter Stellen: 3,75
- Zeitarbeit: 2,75 (Mittelwerte: 5 = sehr wirksam, 4 = eher wirksam, 3 = weder wirksam noch unwirksam, 2 = weniger wirksam, 1 = gar nicht wirksam)
Folgen des Personalmangels
- Höhere Arbeitsbelastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 77,6 Prozent (2022: 76,1 Prozent)
- Aufträge/Mandate/Patienten mussten abgelehnt werden: 67,9 Prozent (2022: 62,9 Prozent)
- Dienstleistung kann nur noch eingeschränkt erbracht werden: 45,6 Prozent (2022: 43 Prozent)
- Projekte etc. mussten verschoben werden: 43,7 Prozent (2022: 42,8 Prozent)
- Unternehmenswachstum gefährdet: 42,5 Prozent (2022: 48,8 Prozent)
- Kunden etc. sind abgewandert: 30,9 Prozent (2022: 28,1 Prozent)
- Öffnungszeiten wurden eingeschränkt: 30 Prozent (2022: 23,1 Prozent)
- Vorzeitiger Eintritt in den Ruhestand geplant: 13,8 Prozent (2022: 6,7 Prozent)
- Geschäftsaufgabe geplant: 9,8 Prozent (2022: 7,2 Prozent)
Zeitspanne, in der die Arbeit noch erbracht werden kann
13,2 Prozent der Befragten befürchten, ihre üblichen Leistungen und Angebote höchstens noch sechs Monate erbringen zu können. Über sechs bis zwölf Monate geben 30,2 Prozent an, über ein Jahr bis zwei Jahre 21,6 Prozent, über zwei bis fünf Jahre 22,4 Prozent und über fünf Jahre 12,6 Prozent.
Zeitaufwand für bürokratische Tätigkeiten
8,2 Prozent der Befragten verwenden bis zu zwei Stunden in der Woche für bürokratische Tätigkeiten, die nicht zu den Kernaspekten ihrer freiberuflichen Tätigkeit (Dokumentationspflichten etc.) gehören. Bei 18,9 Prozent fallen über zwei bis fünf Stunden an. 30,6 Prozent beziffern diesen Aufwand auf über fünf bis zehn Stunden. Bei 30,5 Prozent schlagen über zehn bis 20 Stunden zu Buche und bei 11,8 Prozent über 20 Stunden. Im Schnitt wenden die Befragten 27 Prozent ihrer Wochenarbeitszeit dafür auf.
Über die Umfrage
Repräsentative Umfrage des Instituts für Freie Berufe (IFB) im Auftrag des BFB vom 4. Oktober bis 6. November 2023 unter knapp 1.600 Freiberuflerinnen und Freiberuflern zur Einschätzung ihrer aktuellen wirtschaftlichen Lage, der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung in den kommenden sechs Monaten, ihrer Personalplanung und Kapazitätsauslastung. Im Sonderteil wurde der Fachkräftemangel in den Blick genommen.
Verantwortlich:
Petra Kleining Mobil: 0177-4265861
Pressesprecherin Telefon: 030-284444-39
Reinhardtstr. 34 Telefax: 030-284444-78
10117 Berlin
petra.kleining@freie-berufe.de