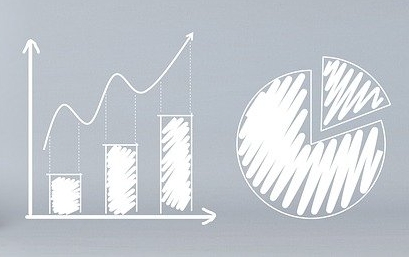Innovationskonferenz „Franchise für Ärzte“
Am 29. März 2022 findet der erste digitale Innovationskonferenz der Steuerberatungsgesellschaft ETL ADVISION und dem Deutschen Franchiseverband zum Thema „Franchise für Ärzte – Neue Wege für das Gesundheitswesen“ statt. Ziel der Konferenz ist es, das Bewusstsein der Gesundheitsbranche für Franchising und Systempraxen zu stärken. Unter der Moderation von Hauke Gerlof, stellvertretender Chefredakteur der Ärzte Zeitung, und nach dem einführenden Vortrag von Torben Leif Brodersen, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Franchiseverbandes, referieren unter anderem Janine Peine, Steuerberaterin und Branchenleitung von ETL ADVISION, Keynote-Speaker Dr. Sami Gaber, Gründer von docport, sowie der Zahnarzt Dr. Kaweh Schayan-Araghi, Betreiber der ARTEMIS-Unternehmensgruppe. Auf Vermittlung des BFB dabei ist Dr. Bernhard Gibis, Leiter des Dezernats Sicherstellung und Versorgungsstruktur der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, bei der Paneldiskussion zum Thema „Das System der Systempraxis – Neue Chancen für Ärzte und Investoren“. Anmeldung zur kostenlosen Veranstaltung hier.